Schnitt-Workshop II: Handlungsschnitt, Szenenumschnitt, Zwischenschnitt und Farbgebung
Ein ungeschnittener Film kann nur bedingt eine Geschichte erzählen, wenn überhaupt. Erst im Schnittprogramm erweckt der Cutter den Film zum Leben – mit Musik, Farbstimmung sowie den passenden Schnitttechniken. Das muss aber nicht den Profis vorbehalten sein. Das Beherrschen der Grundlagen des Videoschnitts führt meist schon zu tollen Ergebnissen – und ist Grundlage für weitere, ehrgeizigere Projekte.
Und das ist genau die Intention dieses Workshops: Er soll simpel und einfach erklären, woran man sich beim Videoschnitt auf jeden Fall halten sollte, schreibt aber nicht vor, wie der Film letztlich zu gestalten ist. Auch geht es weniger darum, die einzelnen Funktionsschritte der Software genau zu erläutern – da lenkt der Spieltrieb den Cutter meist von selbst.
Als Schnittprogramm setzen wir hier CyberLinks Power Director 11 ein. Auch wenn die Screenshots aus diesem Programm stammen, lassen sich die Tipps für die Filmgestaltung auch mit jedem anderen Schnittprogramm umsetzen.
Im ersten Teil unseres Schnittworkshops in Ausgabe 06/2012 beschäftigten wir uns mit den Vorarbeiten des Schnitts; erklärten, wie man sein Material importiert, sinnvoll sortiert und richtig benennt. Außerdem widmeten wir uns dem Filmvorspann und den Einstellungslängen. An welchen Schnitttechniken sich Profis orientieren, wollen wir im zweiten Teil erläutern. Außerdem gehen wir auf Bildkorrekturen ein und zeigen, wie eine bestimmte Farbgebung im Video zu einer anderen Wahrnehmung beim Betrachter führt.
Handlungsschnitt
Mit dem Handlungsschnitt entsteht eine Szene, die eine Situation genauer verdeutlicht. Dafür nutzt der Cutter Bildfolgen, die in der Halbnahen oder Nahen entstanden sind. Das Wechseln eines Bilds aus der Totalen in die Halbnahe signalisiert dem Zuschauer, dass diese Situation im Film wichtiger ist. Unser Beispielprojekt handelt von einem diebischen Eismann, der von einem Jungen bei seinem illegalen Tun ertappt wird: Er stiehlt Geldbörsen! Im Film verfolgt der Junge im gelben T-Shirt den fliehenden Eismann und kürzt den Weg durch einen Abwasserkanal ab, um Zeit zu gewinnen.
Im Film sieht das so aus: Der Junge dreht den Kopf in Richtung Abwasserkanal. Die Kamera schwenkt auf den Kanal. Verweilt in der Nahen auf der Öffnung. Der Junge steigt in den Kanal.

Ganz im Detail sieht der Zuschauer nicht, wie der Junge in den Abwasserkanal steigt. Das Verkürzen der Handlung von der Nahen des Kanaleinstiegs hin zum Abstieg sorgt aber für Dynamik und einen besseren „Flow" des Films.
Weitere Schnitt-Workshops:
Schnitt-Vorbereitung, Vorspann und Einstellungslänge Ton, Filmabspann und Filmexport YouTube, Vimeo und Co. optimal nutzen Mit Effekten und Titeln Blicke auf Inhalte lenken Wie man in der Timeline schön erkennt, wechselt das Bild am Ende der Szene vom Jungen aus der Halbnahen hin in eine Halbnahe auf den Eismann: Für den Betrachter entsteht so eine Sichtbeziehung.
Wie man in der Timeline schön erkennt, wechselt das Bild am Ende der Szene vom Jungen aus der Halbnahen hin in eine Halbnahe auf den Eismann: Für den Betrachter entsteht so eine Sichtbeziehung.
Der Kameraschwenk auf den geöffneten Kanal signalisiert die Kopfbewegung des Jungen, die Nahaufnahme der Öffnung seine Idee, den Kanal als Abkürzung zu nutzen. Im nächsten Bild ist er bereits dabei, einzusteigen. Den kleinen Handlungssprung zwischen diesen letzten beiden Einstellungen bemerkt der Zuschauer nicht. Der Sprung ist sogar nötig, denn der Trick liegt im Verkürzen von Handlungssträngen, was für eine bessere Dynamik sorgt. Aber Achtung: Soll der Zuschauer in einer Aufnahme eine Beschriftung, auf einem Schild etwa oder eine SMS, lesen können, gilt: Der Clip muss so lange zu sehen sein, wie man selbst braucht, um sich den Text laut vorzulesen.
Szenenumschnitt
Der Szenenumschnitt findet in der Regel zwischen zwei Handlungsschnitten statt. In unserem Beispielprojekt liegt der Fokus zu Beginn des Films zunächst auf dem Gesicht des Jungen, der in der Sonne träumt und vom sich lautstark nähernden Eismann geweckt wird. Als der Junge die Augen aufschlägt, wechselt die Szene und zeigt den Eismann aus einer Halbnahen von vorne. Dadurch baut der Szenenumschnitt eine Sichtbeziehung zwischen Betrachter und Eismann auf – der Zuschauer blickt quasi durch die Augen des Jungen. Filmeinsteiger flüchten sich zwischen zwei Szenen oft in Verlegenheits-Effekte: Das Bild „verwirbelt", verpixelt oder wird kurz schwarz. Solche Effekte sollte man vermeiden. Denn selbst wenn es sich dabei lediglich um eine Blende handelt, vermitteln sie meist den Eindruck, dass eine bestimmte Situation im Film nun beendet sei. Wird aber nach dem Effekt der Handlungsstrang weitergeführt, wirkt das unharmonisch – der Zuschauer wird aus dem Filmfluss gerissen. Deshalb gilt: Effekte und Blenden immer gezielt einsetzen und nicht als Verlegenheitslösung einschieben.
Auf der nächsten Seite finden Sie die Erklärungen zum Zwischenschnitt und zur Bildkorrektur.
Zwischenschnitt
Der Zwischenschnitt, bei fortgeschritteneren Cuttern auch „Insertschnitt" genannt, findet immer dann Anwendung, wenn eine Bildfolge aus dem eigentlichen Handlungsablauf gehoben wird. Die Audio-Spur der eingeschobenen Szene wird dabei nicht geschnitten, stattdessen bleibt der Ton der eigentlichen Handlung erhalten. Ein Dialog zwischen zwei Personen läuft also trotz Zwischenschnitt weiter. In unserem Beispiel treibt der verfolgende Junge den diebischen Eismann gegen Ende des Films auf einem Bootssteg in die Enge. Der will die gestohlenen Brieftaschen im See verschwinden lassen und wirft sie eine nach der anderen mit einer lockeren Handbewegung über die Schulter. Amüsanterweise fährt genau in diesem Moment ein kleines Motorboot hinter ihm vorbei, in dem sich die drei Handtaschen befinden, aus denen er zuvor die Brieftaschen entwendet hat. Dort landen die weggeworfenen Geldbörsen.
Unser Zwischenschnitt sieht dann folgendermaßen aus: Die Handbewegung des Eismanns ist jeweils noch im Bild, während das jeweils fallende Portemonnaie das Bild verlässt. Hier setzt der Cutter den Zwischenschnitt und zeigt die Fallbewegung des Geldbeutels in die Handtasche. Findet in diesem Moment ein Dialog zwischen dem Eismann und dem Jungen statt, fährt dieser ohne Unterbrechung fort.
Wie schon beim Handlungsschnitt führt eine Verkürzung der Handlung zu einer besseren Dynamik des Films. Ideal ist es, wenn man den Zwischenschnitt bereits im Vorschaufenster kürzt und den Ton abtrennt. So kann man die jeweiligen Filmschnipsel auf der Timeline später in eine eigene Spur legen, welche die Haupt-Video-Spur überlagert, und beugt versehentlichen Tonfehlern im Projekt vor.
Damit Szene und Dialog synchron laufen, hilft die Waveform-Darstellung der Audio-Spur auf der Timeline. Man orientiert sich am besten an markanten Tönen mit einem „K" oder „P" im Wort: Die sind anhand des Pegelausschlags in der Audio-Spur gut auszumachen. Den Ausschlag des Wortbeginns setzt man dann deckungsgleich mit der Zeitnadel der gewünschten Szene.
 Die Handtasche in unserem Beispiel ist eigentlich nicht Teil des Handlungsablaufs, trotzdem verstärkt sie das Verstehen der Handlung: Der Zuschauer sieht genau, wie die Geldbörsen in der jeweiligen Tasche landen.
Die Handtasche in unserem Beispiel ist eigentlich nicht Teil des Handlungsablaufs, trotzdem verstärkt sie das Verstehen der Handlung: Der Zuschauer sieht genau, wie die Geldbörsen in der jeweiligen Tasche landen.
 Die Situation in der Seitengasse eskaliert. Es gilt: Die Lichtstimmung ist wesentlich für einen homogen wirkenden Film. Je nach Stimmung oder Set können aber auch unterschiedliche Lichtverhältnisse für bestimmte Emotionen beim Zuschauer sorgen und das Empfinden verstärken.
Die Situation in der Seitengasse eskaliert. Es gilt: Die Lichtstimmung ist wesentlich für einen homogen wirkenden Film. Je nach Stimmung oder Set können aber auch unterschiedliche Lichtverhältnisse für bestimmte Emotionen beim Zuschauer sorgen und das Empfinden verstärken.
Bildkorrektur
Neben den Schnitttechniken ist die richtige Lichtstimmung im Videoprojekt von Bedeutung. Beim Außendreh ist es fast unmöglich, stets die gleichen Lichtverhältnisse beizubehalten. Profis setzen deshalb stets auf große Lichtanlagen und drehen möglichst autark vom Tageslicht.
Mit kleinem Budget geht das aber nicht. Wenn ein Film über mehrere Tage entsteht, müssen also die verschiedenen Lichtsituationen in der Schnittsoftware ausgeglichen werden. Wichtig ist, dass Helligkeit, Kontrast und Farbtönung zueinander passen (viele Filmer kennen das Problem eines falschen Weißabgleichs). Meist reicht es aber, wenn man im ersten Schritt Helligkeit und Kontrast anhebt oder abflacht.
Je nach Set und gewünschter Filmstimmung kann man die Farbgebung aber auch gezielt ändern, um dem Zuschauer eine bestimmte Stimmung zu vermitteln. In unserem Film gerät unser Protagonist bei seiner Verfolgungstour in eine Seitengasse mit zwei zwielichtigen Gestalten. Hier bietet es sich an, die bisweilen sonnige und sommerliche Atmosphäre mit einem etwas blasseren, kühleren Farbton abzuschwächen und dadurch eine bedrohlichere, kältere Situation zu schaffen. Da in der Seitengasse der Lichteinfall der Sonne von einem Haus versperrt ist und so schattigere Verhältnisse herrschen, wirkt eine solche Lichtstimmung authentischer. Der Zuschauer wird diesen Wechsel unterbewusst wahrnehmen. Man kann so Emotionen wieder gezielt steuern und Wohlbefinden oder auch Unbehagen hervorrufen. Der Power Director 11 bietet hierfür eine Vielzahl an Effekten, man kann den Farbton aber auch gezielt über die Schaltfläche „Korrigieren/Verbessern" einstellen. Anhand von Keyframes lässt sich die Farb-Änderung sogar bis zum Höhepunkt der Szene hin steigern, zum Ausklang der Szene wieder abschwächen und für den weiteren Verlauf des Films normalisieren. Auch den Weißabgleich packt CyberLink beim Power Director 11 in den „Korrigieren/Verbessern"-Dialog.
(jos/pmo)
Autor: |
Bildquellen: |
Weitere Praxis-Artikel

Praxistest: Datacolor LightColor Meter – mehr als ein Belichtungsmesser
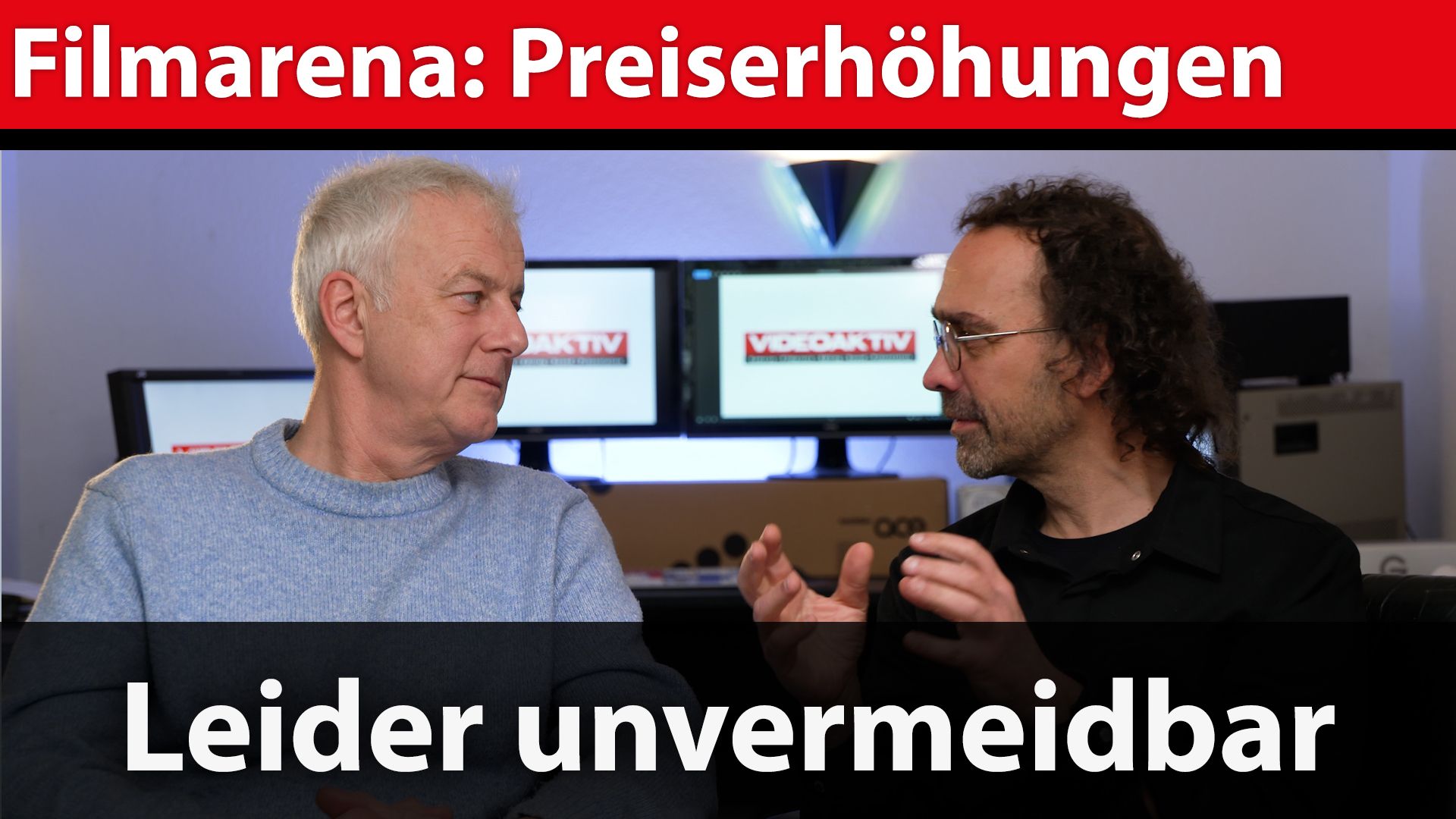
Filmarena: Preiserhöhungen – unvermeidbar, aber unangenehm



