Workshop: Filmprojekte richtig exportieren
Wenn es an den Export der „richtigen" Videodatei geht, schaut man auch bei engagierten Filmern oft in fragende Gesichter. Eine große Zahl an Videoformaten mit vielen modifizierbaren Parametern sorgt für ebenso große Unsicherheit, ob man denn auch alles optimal eingestellt hat. Damit das eigene Video auf Medienspielern und Videoportalen rund läuft, sind Werte wie Bildrate und GoP-Länge (Group of Pictures) essenziell. Selbsterklärend sind diese Begriffe aber nicht. Umso wichtiger, sich einmal richtig mit den korrekten Einstellungen auseinanderzusetzen, denn eigentlich ist der Export recht einfach. Wir erklären, wie man eine passende Videodatei zustande bekommt.
Problem Formatvielfalt
Eines vorweg: Das eine passende Format für alle Situationen gibt es nicht. Dafür existieren einfach zu viele Dateiformate,Geräte und Videoportale, die alle unterschiedliche Anforderungen stellen. Wichtiger Punkt: Allein das Dateiformat sagt noch nichts darüber aus, mit welcher Kompression die Videodaten kleiner gerechnet werden. Denn in Dateien mit der Endung „.mov" (Apple QuickTime), „.avi" (Microsoft Audio Video Interleave) oder „.mp4" können ganz unterschiedliche Codecs stecken, auch wenn es zur Zeit meist der gängige H.264-Codec ist. Es kann also sein, dass der Rechner, Media- oder Blu-ray-Player zwar AVI-Dateien prinzipiell wiedergeben kann, aber Dateien mit einem speziellen Codec trotzdem nicht öffnet. Selbst hinter dem üblichen AVCHD-Videoformat können zig verschiedene Varianten stecken: Die Datenrate ist dabei genauso variabel wie die Bildrate bis hin zu 50 Vollbildern. Daneben gibt es noch die sogenannte „Interlaced-Aufzeichnung" mit 50 Halbbildern.

Der Film ist im Kasten – und geschnitten ist er auch schon. Wie man ihn nun am besten exportiert und präsentiert, erklären wir in diesem Schnitt-Ratgeber.
Weitere Schnitt-Workshops:
Standardeffekte beim Videoschnitt Ton verbessern und effektvoll mischen Effekte und Titel: Blicke auf Inhalte lenken Motion Tracking: Objektverfolgung für Einsteiger Handlungsschnitt, Szenenumschnitt, Zwischenschnitt und Farbgebung Ton, Filmabspann und Filmexport YouTube, Vimeo und Co. optimal nutzen Kreativer Videoschnitt für Einsteiger Adobes Premiere Pro bietet die GoP-Einstellungen über den Media-Encorder. Die Bezeichung lautet hier „Keyframeabstand" (links). Bei Magix Video Pro X wird die GoP-Länge über die Exporteinstellungen und nach Klick auf die Schaltfläche „ Erweitert" festgelegt. Die deutschen Entwickler betiteln die Option am verständlichsten (rechts).
Adobes Premiere Pro bietet die GoP-Einstellungen über den Media-Encorder. Die Bezeichung lautet hier „Keyframeabstand" (links). Bei Magix Video Pro X wird die GoP-Länge über die Exporteinstellungen und nach Klick auf die Schaltfläche „ Erweitert" festgelegt. Die deutschen Entwickler betiteln die Option am verständlichsten (rechts).
Damit sind es allein schon fünf Variablen, die jeder Hersteller beliebig festlegen kann, was somit 25 verschiedene Videoformate ergibt. Tatsächlich ist die Vielfalt sogar noch größer.
Die Master-Datei
Bei den meisten Schnittprogrammen gelangt man in der Regel über eine „Exportieren"-, „Produzieren"- oder „Ausgabe"- Schaltfläche zur Format-Wahl. Dort bietet das Programm dann diverse Exportoptionen und lässt auch das Einstellen eigener Benutzerprofile zu. Man kann sich die Sache allerdings erheblich erleichtern, wenn man aufs Dateiformat und Einstellungen des Rohmaterials zurückgreift. Schnittprogramme wie Adobe Premiere Pro, Grass Valley Edius, Cyberlink PowerDirector oder Magix Video deluxe und Video Pro X können für den Export die Projekteinstellungen übernehmen. Der Vorteil ist offensichtlich: Dateiformat, Auflösung und Bildwiederholrate werden übernommen.
Bei der Datenrate lohnt sich ein Blick in die Spezifikationen des Camcorders, denn dies wird nicht übernommen. Eine qualitativ hochwertige Masterdatei bekommt man, wenn die Datenrate auf dem Niveau des Ursprungsmaterials ist. Bei AVCHD wären das entsprechend 25 bis 28 Megabit in der Sekunde. Wer sicher gehen will, kann auch leicht darüber gehen. Für die Wiedergabe auf dem Medienspieler berechnet man eine zweite Datei, wobei man auch hier Auflösung, Bildwiederholrate und Tonfrequenz beibehält. Bei der Datenrate wählt man eine qualitativ hochwertige und wenig verlustbehaftete Variante, die jedoch eine geringere Datenrate hat – um die 12 bis 15 Megabit in der Sekunde.
Für Mac-Nutzer bietet sich hier eine QuickTime-Datei im MOV-Format an. Auf Windows- wie auf Mac-Systemen ist MP4 (H.264/MPEG-4) zu empfehlen.
Die Datenrate sollte variabel (VBR) und nicht konstant (CBR – „Constant Bit Rate") sein. Bei einer konstanten Datenrate wird durchgehend identisch komprimiert, bei der variablen kann der Codec immer dann höher komprimieren, wenn gerade nicht viel Veränderungen im Bild sind, und die Datenrate anheben, sobald dies notwendig wird. Deshalb erstellt man den Film im „2-Pass- Verfahren".
Dann analysiert das Programm im ersten Durchgang, an welcher Stelle es im zweiten Berechnungslauf die Datenrate senken kann oder diese steigern muss, um die Bildqualität zu erhalten. Darum wählt man hier eine sogenannte Zielbitrate und eine maximale Datenrate. Wobei es wenig Sinn ergibt, wenn man die Zielbitrate auf 8 Megabit pro Sekunde stellt, die maximale aber auf 80 Megabit. Diesen Spielraum kann der Codec nicht nutzen. Grobe Faustregel: Die maximale Datenrate kann rund 20 Prozent über der Zielbitrate liegen – das wären in unserem Beispiel von 8 Megabit dann knappe 10 Megabit pro Sekunde.
Ist die qualitativ beste Videodatei gelungen sowie das kleinere Pendant für die Wiedergabe mit Media-Playern geglückt, macht man sich an die Varianten für Internet, YouTube und Mobilgeräte.
Edius Pro 7 versteckt die GoP-Einstellungen etwas: Man klickt nach dem „Produzieren"- Dialog nochmals auf die Schaltfläche „Exportieren" und anschließend auf „Erweiterte Einstellungen". Beim Parameter „IDR-Intervall" ist man richtig.
 Der PowerDirector lässt die GoP-Länge leider nicht bestimmen, hat aber bereits vordefinierte YouTube-Einstellungen. Sogar für 4K-Video.
Der PowerDirector lässt die GoP-Länge leider nicht bestimmen, hat aber bereits vordefinierte YouTube-Einstellungen. Sogar für 4K-Video.
Einstellungen für YouTube
Hartnäckig hält sich die Mär, dass YouTube Videos immer mit 30 Vollbildern wiedergäbe. Doch die Plattform zeigt sich weit offener – sogar für sehr hohe Bild- und Datenraten bis hin zu 4K. Nur wenn die Berechnungseinstellungen korrekt sind, akzeptiert YouTube die Videos, ohne nachträglich einzugreifen. Ein Video wird von YouTube in der Regel mit voller Auflösung, aber immer mit Vollbildern berechnet. Wer mit 50 oder 60 Vollbildern gefilmt hat, sollte das Video in jedem Fall mit dieser Bildrate auf YouTube laden – und nicht etwa auf 25 Vollbilder oder 50 Halbbilder wechseln.
Wer also Wert auf optimale Qualität legt, muss auch hier möglichst viele Parameter aus den Originaldaten des Rohmaterials beibehalten – denn dann ist der Verlust am geringsten. Konkret gesagt: Wer für seinen Film mit einem AVCHD-Camcorder in Full-HD mit 50 Vollbildern und entsprechend 28 Megabit pro Sekunde gedreht hat, sollte auch eine Full-HD-Datei für YouTube mit 50 Vollbildern berechnen. Sogar die Datenrate kann vergleichbar hoch, sogar etwas höher sein. Somit entspricht das schon fast der Master- Datei – wäre da nicht die Sache mit der GoP-Länge. Die sogenannte Group of Pictures (GoP) definiert, wie die Bilderstruktur aus I-, B- und P-Frames aussieht. Die IFrames entsprechen Vollbildern, B-Frames dagegen enthalten nur Veränderungen, beziehen sich aber auf Bilder, die davor und dahinter liegen, während P-Frames sich ausschließlich rückwärtig beziehen. Eine ausführliche Erklärung zum Thema GoP finden sie übrigens auf unserer Homepage unter videoaktiv.tv/51453.
Wichtig für YouTube ist, dass eine Group of Pictures maximal halb so lang ist wie die Bildrate: Bei 50 Vollbildern also 25, bei 24 Vollbildern 12. Leider heißt die GoPEinstellung nicht in allen Schnittprogrammen gleich, ist aber stets bei den Exportoptionen zu finden. Adobe etwa nennt die Einstellung in Premiere Pro „Keyframeabstand". Bei Edius Pro 7 heißt sie „IDR-Intervall", Magix bezeichnet sie in Video Pro X am verständlichsten mit „GOP-Länge".
Richtig Präsentieren
Ist der Upload geglückt, geht's ans Präsentieren des eigenen Films, bestenfalls direkt aus dem YouTube-Kanal auf dem Fernseher. Alle modernen Fernsehgeräte unterstützen die Applikation direkt aus dem Smart-TV-Menü heraus, und bei älteren Full-HD-TV lässt sich mit einem Media- Player der Anschluss leicht herstellen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Videos sind auf dem eigenen YouTube-Kanal gespeichert und stets verfügbar – quasi eine Art Online-Videoarchiv direkt zum Präsentieren.
Möchte man seine Videos nicht mit der halben Welt teilen, genügt es, die eigenen Videos in den Profil-Einstellungen auf „nicht gelistet" zu setzen. Damit können nur noch diejenigen das Video sehen, die den direkten Link mitgeteilt bekommen haben. Das ist der Unterschied zu privaten Videos, die man nur dann abrufen kann, wenn man das Passwort zum YouTube-Kanal hat. Alternativ kann man natürlich die für den Media-Player erstellte Videodatei auf eben einen solchen speichern und dann direkt abspielen oder auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte kopieren und von dort wiedergeben.
Moderne Fernseher kommen heute in der Regel mit allen gängigen Videoformaten wie MPEG-4 oder MOV zurecht. Trotzdem ist es wichtig, von vornherein zu klären, welche Dateien der eigene Fernseher oder Medienspieler versteht.
(pmo/jos)
Damit die eigenen YouTube-Videos nur für ausgewählte Zuschauer zu sehen sind, muss unter den Videoeinstellungen anstatt „öffentlich" die Option „nicht gelistet" gewählt sein.
Autor: |
Bildquellen: |
Weitere Praxis-Artikel

Praxistest: Datacolor LightColor Meter – mehr als ein Belichtungsmesser
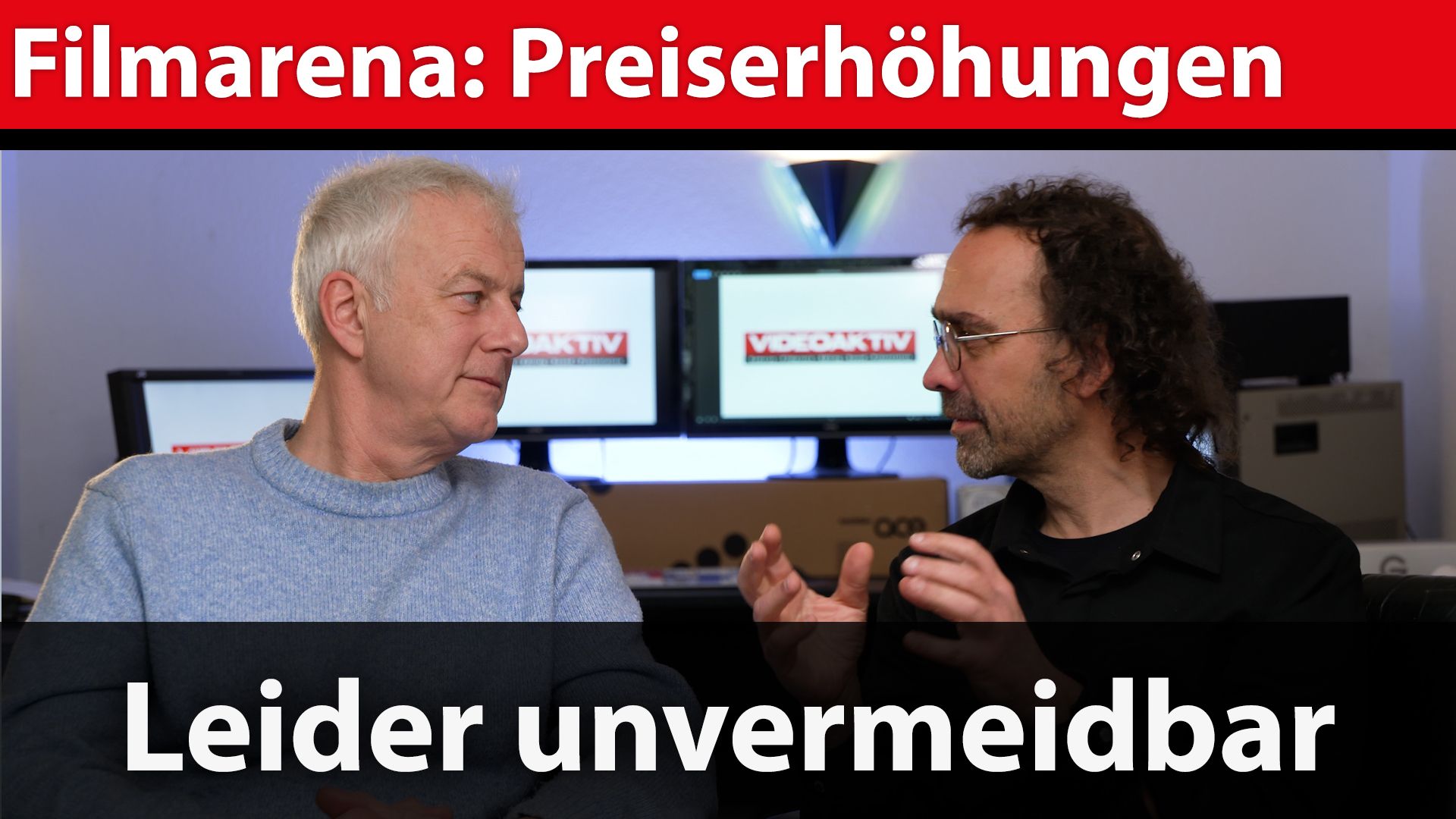
Filmarena: Preiserhöhungen – unvermeidbar, aber unangenehm





