Motion Tracking: Objektverfolgung für Einsteiger
Motion Tracking verlangt potente Rechenmaschinen, leistungsstarke Programme und talentierte Techniker. Ohne Frage, so entstehen in Hollywood beeindruckende Filmeffekte, die der Zuschauer unter Umständen nicht mal als Effekt erkennt, sondern als Filmrealität akzeptiert. Wenn ein Effekt so gut ankommt wie das Motion Tracking, dauert es meist nicht lange, bis man ihn auch mit weit weniger Aufwand und mit kleineren Programmen hinbekommt. Beim Motion Tracking, zu Deutsch Bewegungsverfolgung, hat das allerdings ganz schön gedauert – und etwas Ideen und Zeiteinsatz sind auch heute noch notwendig. An einem Einsteiger-Beispiel zeigen wir, wie eine solche Produktion aussehen kann.
Als Programm nutzten wir den für Einsteiger einfach zu bedienenden ColorDirector von CyberLink. Die Bewegungsverfolgung findet sich aber auch in vielen anderen Schnittprogrammen, weshalb die Tipps dieses Ratgebers allgemeingültig sind.
Das Motion Tracking
Die Bewegungsverfolgung ist verwandt mit dem ähnlich klingenden, aber doch unterschiedlich funktionierenden „Motion Capturing". Auch wenn die beiden Verfahren oft ineinander verschwimmen, kann man sie nicht direkt vergleichen: Das eine beginnt also bereits am Set bei der Aufnahme, das andere erfolgt erst in der Postproduktion am Rechner.
 Der Ballon liegt noch am Boden und ist nur mit wenig Luft gefüllt. Wir umrahmen die Kontur des Flugobjekts, invertieren die Maske (dadurch wird der Hintergrund maskiert) und entziehen dem Bild die Sättigung. Der Ballon bleibt farbig.
Der Ballon liegt noch am Boden und ist nur mit wenig Luft gefüllt. Wir umrahmen die Kontur des Flugobjekts, invertieren die Maske (dadurch wird der Hintergrund maskiert) und entziehen dem Bild die Sättigung. Der Ballon bleibt farbig.
 Gerade bei Objekten, die sich schnell bewegen, oder solchen mit unterschiedlichen Bewegungsmustern (Menschen oder Tieren etwa) hat die Bewegunsverfolgung ihre Probleme und kommt nicht hinterher.
Gerade bei Objekten, die sich schnell bewegen, oder solchen mit unterschiedlichen Bewegungsmustern (Menschen oder Tieren etwa) hat die Bewegunsverfolgung ihre Probleme und kommt nicht hinterher.
Das Motion Capturing fängt die Bewegung eines Darstellers oder eines Tieres mittels vieler Kameras und eines speziellen Anzugs mit Sensoren ein, um darauf im Rechner einen virtuellen Charakter zu legen; Gollum aus „Der Herr der Ringe" ist dafür wohl das berümteste Beispiel. Das Motion Tracking hingegen beschreibt die Verfolgung eines Objekts im bewegten Bild mit Hilfe einer definierten Maske, wie man sie aus der Photoshop-Software kennt. Zwar geht das Motion Tracking in großen Kinoproduktionen meist mit dem Motion Capturing einher, funktioniert aber auch komplett getrennt davon und ist auch für den Hobby-Cutter kein unerreichbares Ziel.
Ein einfachstes Beispiel dafür ist die Verfremdung eines Auto-Kennzeichens oder Gesichts, was immer dann nötig ist, wenn das Video ohne Genehmigung der zu sehenden Person auf öffentlichen Videoportalen eingestellt werden soll. Aufwändiger wird es, wenn ein Objekt im Film stilistisch herausgehoben werden soll, etwa mit einer veränderten Farbgebung oder einer leuchtenden Aura. Auch dann kommt die Bewegungsverfolgung (teils auch Rotoscoping genannt) zum Einsatz, wobei das ein- oder umgefärbte Element stets mit der darüberliegenden Maske synchron laufen muss.
Das Prinzip lässt sich noch weiter spinnen: Mächtige Programme wie Adobe After Effects oder Blender können bestimmte Objekte im Film, die als dreidimensionale Platzhalter dienen, mit einer grafischen Textur versehen und Eindrücke im Film schaffen, die in der Realität so gar nicht bestehen – etwa Lichtschwerter aus der Filmreihe »Der Krieg der Sterne".
Aus der Praxis
Für unser praktisches Beispiel wollen wir eine Ballonfahrt optisch etwas aufpeppen. Noch bevor der Ballon sich in die Luft erhebt, wird er mit Gas gefüllt, sein Volumen nimmt zu. Das Fluggerät soll vom restlichen Bild „abgekoppelt" werden. Dafür soll der Hintergrund schwarzweiß werden, nur der Ballon soll farbig bleiben und in der Sättigung etwas dazugewinnen, damit er vom Betrachter noch intensiver wahrgenommen wird.
Um das zu erreichen, muss man dem Programm erst einmal mitteilen, welches Objekt verfolgt werden soll – in diesem Fall also die Proportionen des Ballons. Das klappt über das Maskenwerkzeug im Bewegungsverfolgungs-Modus des ColorDirectors, den man in der linke Menüleiste findet. Er wandelt den Mauszeiger in ein umrandetes Plus für „Pinsel" oder ein umrandetes Minus für den „Radierer". Hiermit setzt man die Maske oder macht falsche Markierungen wieder rückgängig. Mit Hilfe des Mausrads legt man einfach und schnell die Größe des Pinsels fest und kann so große Masken schneller erstellen oder detaillierte Bereiche präziser bestimmen.
Unser Beispiel zeigt: Wenn der Ballon mit Gas gefüllt wird, gewinnt er an Volumen, das Programm sollte nun die Bewegung und die Vergrößerung des Objekts automatisch nachvollziehen und mit der Maske verfolgen. Da das aber so gut wie nie optimal funktioniert, müssen wir hier nacharbeiten. Dafür pausiert man die Bewegungsverfolgung (im ColorDirector über das entsprechende Symbol) und setzt die Maske neu an, sobald sie mit dem Objekt nicht mehr hundertprozentig synchron läuft. Im ColorDirector ist das an der dicken roten Umrandung um das maskierte Objekt gut zu erkennen. Mit der Alt-Taste schaltet man dabei flott zwischen Pinsel und Radierer hin und her und weitet oder reduziert die Maske nach Bedarf.
Damit der Übergang zwischen grauem Hintergrund und dem farbigen Objekt „weicher" aussieht, empfiehlt es sich, die Kanten weicher darzustellen. Dafür gibt es im ColorDirector einen eigenen Schieberegler, links in der Effekt-Palette.
 Der ColorDirector lässt auch das Maskieren mehrerer Objekte im Bild zu. Hier etwa sind die beiden Ballonplanen mit zwei Masken versehen, um sie unterschiedlich einzufärben oder vom Hintergrund abzuheben.
Der ColorDirector lässt auch das Maskieren mehrerer Objekte im Bild zu. Hier etwa sind die beiden Ballonplanen mit zwei Masken versehen, um sie unterschiedlich einzufärben oder vom Hintergrund abzuheben.
Schnelle Bewegungen
Bei sich schnell bewegenden Elementen ist bildgenaue Nacharbeit meist nicht zu vermeiden. Deshalb sollte man das Rohmaterial vor dem Zuschneiden im Schnittprogramm erst mal ins Motion-Tracking-Werkzeug laden und dort sichten, um festzustellen, ob sich die Szene für eine Bewegungsverfolgung eignet. Ist die Bewegung des Objekts im Video zu schnell, wird das Programm oft die Maskierung verlieren. Gerade bei Menschen oder Tieren haben fast alle Motion-Tracking-Werkzeuge Probleme und erkennen Teilbereiche des zu verfolgenden Objekts nicht – bei Arm-, Fuß- oder Beinbewegungen ist das gut zu sehen. Hier kann es helfen, im Schnittprogramm eine leichte Zeitlupe auf den Clip anzuwenden, diesen gegebenenfalls zu kürzen und erst dann mit der Bewegungsverfolgung zu beginnen. Das menschliche Auge nimmt eine Verlangsamung auf 80 bis 85 Prozent der Abspielgeschwindigkeit meist noch als natürlich wahr.
Bereits geschnittene und korrigierte Clips sollte man direkt aus der Schnittsoftware im Motion-Tracking-Werkzeug verschönern, damit man für den Film keine unnötigen Bilder bearbeitet. Möchte man den gesamten Film mit einem gleich bleibenden Stil versehen, sollte man bedenken, dass sich eine komplette Timeline aus kaum einem Schnittprogramm gesammelt ins „Rotoscoping-Tool" übertragen lässt. Die einzelnen Szenen müssen also separat angepasst werden.
Leider bieten die meisten Programme nicht das gleichzeitige Bearbeiten von Hinterund Vordergrund an. Im ColorDirector etwa lässt sich lediglich die gesetzte Maske im Vordergrund oder die Umkehr davon modifizieren, nicht aber beides simultan. Was aber geht: Man kann mehrere Objekte im Clip mit einer Maske versehen und unterschiedliche Farbstimmungen oder Helligkeitswerte im Video schaffen.
Der Ballon in unserem Beispiel hebt wenig später ab. Um den einheitlichen Stil beizubehalten, möchten wir nun lediglich die beiden blauen Ballon-Planen einfärben. Dafür muss man zwei Bereiche maskieren. Also umrahmt man beide Objekte mit einer Maske, bis die Kanten anliegen, und invertiert die Ansicht über das „Maske umkehren"-Symbol in der Effekt-Palette. Dann reduziert man die Sättigung: Der Hintergrund verliert an Farbe; nur die Planen bleiben blau! Zusätzlich ließe sich noch mit der Schärfentiefe spielen – maskierte Bereiche im Bild lassen sich also nicht nur um die Farbe reduzieren, umfärben oder heller und dunkler machen: Auch die Schärfe im Bild kann man beeinflussen und Objekte völlig unkenntlich machen.
Weiche Kanten
Praktisch im ColorDirector ist zudem die „Weiche Kanten"-Option. Mit ihr kann man den Übergang zwischen maskiertem Objekt und dem Rest etwas weicher gestalten, wodurch die Abgrenzung nicht ganz so „hart" ausfällt. Wie für weite Teile des Videoschnitts gilt auch hier: Experimentieren Sie mit dem Werkzeug, einem Stil!
Ideal für Experimentierfreudige ist auch die Keyframe-Funktion, die der ColorDirector über das kleine „Uhren-Symbol" oberhalb der Effekt-Palette bereitstellt. Mit ihr lassen sich Farbveränderung zeitlich noch genauer bestimmen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten Teile eines in Schwarzweiß gehaltenen Videos im Sekundentakt einfärben und anschließend wieder verblassen lassen, eventuell noch einen hellen Akzent setzen. Mit Hilfe der Definition von Schlüsselbildern ist das kein Problem – und der „Wow-Effekt" bei der nächsten Präsentation ist garantiert.
(pmo)
 Die Bewegungsverfolgung erlaubt nicht nur, mit der Farbe zu spielen: Auch die Schärfe von Objekten und Hintergrund kann man so beeinflussen und dadurch gezielt Akzente im Bild setzen.
Kreative Ideen
Die Bewegungsverfolgung erlaubt nicht nur, mit der Farbe zu spielen: Auch die Schärfe von Objekten und Hintergrund kann man so beeinflussen und dadurch gezielt Akzente im Bild setzen.
Kreative Ideen
Ein farbiger Akzent
Aus vielen Kinofilmen bekannt, etwa bei „Schindlers Liste" oder „Sin City": Die Farbgebung des gesamten Films wird in Schwarzweiß gelegt, lediglich ein Detail, das im Film immer wieder auftaucht, bleibt farbig. Etwa eine rote Rose oder ein farbiger Hut.
Helle und dunkle Szenarien
Mit Motion Tracking lassen sich Bereiche im Videobild gezielt verdunkeln und andere heller darstellen. Das wirkt sich auf die Stimmung des Films aus und kann einen bestimmten künstlerischen Eindruck vermitteln.
Künstliche Schärfentiefe
Auch die Schärfe auf Objekten oder im Hintergrundlässt sich durch Rotoscoping beeinflussen. Teile des Bilds kann das Programm somit unschärfer darstellen, was den Blick des Betrachters auf das Objekt im Vordergrund lenkt.
Objekte mit Texturen
Viele Hollywood-Filme machen es vor: Sie können einen Karton oder eine tragbare Wand im Video als Platzhalter vorsehen und diesen nachträglich mit einer eigenen Grafik oder einem Text belegen und das Objekt verfolgen lassen. Das funktioniert aber nur in leistungsstärkeren Motion-Tracking-Werkzeugen.
Verfremdungen
Eine der einfachsten Zwecke, wofür Motion Tracking gebraucht wird: Personen oder Auto-Kennzeichen in öffentlich gezeigten Videos verfremden. Per Bewegungsverfolgung und dem Verringern der Schärfe werden diese Objekte unkenntlich – die Maske wandert mit.
Autor: |
Bildquellen: |
Weitere Praxis-Artikel

Praxistest: Datacolor LightColor Meter – mehr als ein Belichtungsmesser
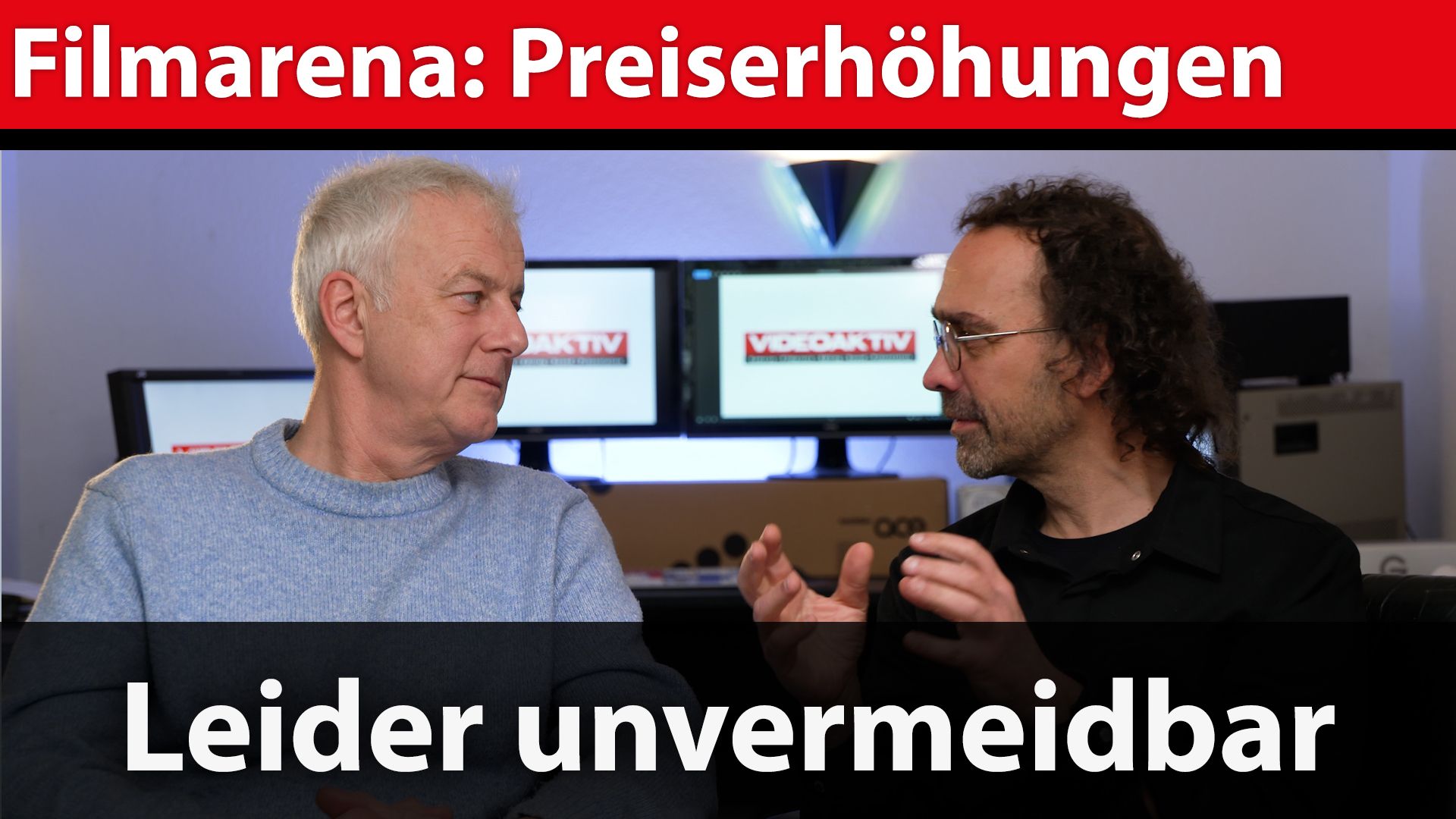
Filmarena: Preiserhöhungen – unvermeidbar, aber unangenehm




