Workshop: Acht Tipps für außergewöhnliche Drohnenaufnahmen
 Workshop: außergewöhnliche Drohnenaufnahmen
Workshop: außergewöhnliche Drohnenaufnahmen
Erschwingliche und von Laien bedienbare Kameradrohnen gibt es inzwischen seit zehn Jahren. Die neue Drohnengeneration lässt sich mittlerweile bequem per Rucksack bis in die höchsten Bergregionen tragen oder gar als Pack in der Größe eines Herrenhandtäschchens die Strandpromenade entlangschlenkern. Drohnenbilder sind allgegenwärtig, kaum noch eine Video- oder TV-Produktion kommt ohne solche Bilder aus. Dabei ist es mehr denn je wichtig geworden, Qualität abzuliefern. Mal eben eine Drohne starten, schnell mal drei Bilder aufnehmen und wieder landen? Das geht nur, wenn man weiß welche Flugaufnahmen besonders gut wirken. Denn die Zuschauer sind mittlerweile höhere Qualitäten gewohnt. Der Einfachheit halber behandeln wir in diesem Workshop DJI-Drohnen, denn bei professionellen Aufnahmen wird man zwangsläufig nicht um die Produkte des Markführers herumkommen. Nicht zuletzt sind auch Konkurrenzmodelle deutlich von DJIs Drohnen beeinflusst, sodass sich die hier aufgeführten Tipps einfach übertragen lassen.
Joachim Sauer und Martin Gremmelspacher verfügen über jahrelange Erfahrung im Fliegen von Kameradrohnen. Viele der im Artikel beschriebenen Tipps lassen sich im Video leichter nachvollziehen, schaut deshalb gerne rein.
FLUGMODI UND RECHTLICHESZunächst: Die ideale Controllereinstellung für die meisten Aufnahmen ist „Cine“ oder, wenn es rasant sein soll, „Normal“. Die Sporteinstellung ist nicht nur für alle Arbeiten abseits von Sport zu schnell, sondern durch die abgeschalteten Abstandssensoren auch den Profis vorbehalten und sollte zunächst ausgeklammert werden. Vor allem Grundvoraussetzung für die Arbeit mit dem fliegenden Auge ist die Einsicht, dass eine Drohne nichts anderes darstellt als ein fliegendes Stativ und damit weitgehend die gleichen Gestaltungsregeln gelten. Entsprechend hat man es leichter, wenn man mit dem Stativ und Kamera bereits Erfahrungen hat. Klar im Vorteil sind zudem Gamer, die bereits reichlich Videospiele per Joystick bedient haben.
Bei jedem Drohnenflug gelten selbstverständlich die Gesetze des jeweiligen Landes, in dem man filmt. So viel Gemeinsamkeiten gibt es jedoch: Flugverbotszonen gibt es in jedem Land und müssen eingehalten werden und Privatgrundstücke dürfen nahezu überall nur mit der Einwilligung der jeweiligen Besitzer überflogen und gefilmt werden. In Europa einheitlich geregelt ist, dass jede Drohne eine Versicherung braucht. In Deutschland muss sich der Drohnenpilot beim Luftfahrtbundesamt registrieren lassen und bekommt eine UAS-Betreiber-ID, die deutlich sichtbar auf der Drohne angebracht werden muss.

Am Anfang befindet sich jede DJI-Drohne immer im Normalmodus, auch wenn die Fernbedienung im Cine-Modus steht. Bevor man fliegt, muss man deshalb immer den Schalter einmal wieder in den gewünschten Modus stellen.
STANDBILD UND DROHNEN-SCHWENK
Die einfachste Art, eine Drohne sinnvoll einzusetzen, ist das Standbild. Denn nur weil sich eine Drohne bewegen kann, heißt nicht, dass sie das auch muss. Gerade wenn im Bild selbst viel passiert oder viele Details sichtbar sind, verwirren vor allem schnelle Drohnenbewegungen die Zuschauer. Das Standbild ist auch die Ausgangsbasis für Bewegtaufnahmen – denn im Idealfall beginnt und endet jede Flugaufnahme sanft und somit setzt man sich einen idealen Ausgangspunkt und endet gezielt an einer passenden Position. Dabei sollte das Endbild in der Regel das bessere sein, sprich die Perspektive, die man eigentlich zeigen möchte. Wer sich hier vornimmt, den Anfang und das Ende um etwa zehn Sekunden stehen zu lassen, hat bereits seine Standbildaufnahmen inklusive.
Natürlich kann ein Schwenk auch einfach die Landschaft zeigen, in der man sich befindet und in diesem Fall als eine Einordnung oder Exposition dienen. In jedem Fall muss – das gilt für die Drohne genau wie für die „normale“ Kamera – hinter jeder Einstellung eine Motivation stehen. Ein Schwenk sollte nie länger dauern, wie es benötigt, um „alles“ gesehen zu haben. Wir empfehlen, langsam und gleichmäßig zu schwenken, was die natürliche Bewegung des menschlichen Kopfes widerspiegelt. Voraussetzung hierzu ist ein sauberes Arbeiten mit dem Joystick. Dabei sollte man einfach anfangen und einen Schwenk in mehrere Richtungen vermeiden. Wichtig ist auch, dass man bei Landschaften nicht zu viel Himmel einbaut, solange sich dort keine interessanten, für die Aufnahme relevanten Wolkenformationen befinden.

Vor allem für ruhigere Videos lohnt es sich, die Drohne auch einmal in der Luft stehen zu lassen. Die beiden Roboter im Bild bewegen sich vergleichsweise schnell und sorgen so für genug Action im Bild.
Für das Auge sind Schwenks von links nach rechts am angenehmsten. Also fängt man links an, sucht sich einen guten Ausschnitt für den Anfang und für das Ende des Schwenks. Jetzt folgt ein Probeschwenk ohne Aufnahme, um jeweils das exakte Ansteuern vom Anfangs- zum Endbild zu trainieren. Durch die Probeschwenks erspart man sich den Bilder-Schrott auf der SD-Karte. Außerdem kann man während des Schwenks das Licht überprüfen, ob es nicht im Verlauf der Bewegung vielleicht zu dunkel oder zu hell wird. Wer die Möglichkeit hat, die Blende manuell mittels Blendenrad an der Fernbedienung zu steuern, sollte das jetzt testen. Aber immer nur so weit, dass die Regelung hinterher nicht oder so gut wie nicht sichtbar wird. Die Lichtregelungen ist auch bei den besten Modellen meist nicht flüssig, sondern etwas „ruckelig“. Die Einstellmöglichkeiten auf den berührungsempfindlichen Bildschirmen von Fernbedienung oder Smartphone sind dazu oft ungenau. Wessen Technik keine Einstellmöglichkeit am Controller bietet, sollte während eines Schwenks nicht auf dem Bildschirm herumtippeln, sondern generell einfach etwas dunkler einstellen, so dass die Position mit dem meisten Licht perfekt belichtet ist. Auto-Belichtung sollte man genau wie Überbelichtung unbedingt vermeiden, daher eher unterbelichten. Im Wesentlichen geschieht hier dasselbe wie mit einer normalen Videokamera.

Einfach mitten in der Bewegung den Joystick loslassen sollte man vermeiden, sonst stoppt die Drohne ebenso rasant und ruckartig.
Jetzt beginnt man die Aufnahme mit dem Anfangsbild: Wichtig ist jetzt, dass die Drohne, das fliegende Stativ, für zehn Sekunden in dieser Position stehen bleibt. Erst dann fängt man gleichmäßig an zu schwenken. Wenn man das Endbild erreicht hat, ist es wichtig, dass die Drohne ganz sanft stehen bleibt und nicht etwa noch nach irgendeiner Seite weiterschiebt. Dazu steuert man, je näher man dem ganz Endbild ist, mit dem Joystick immer geringer und lässt ihn schließlich ganz los. Anschließend die Drohne wieder für zehn Sekunden stehen lassen und dann erst die Aufnahme abschalten. Nun kann man dasselbe nochmal rückwärtsfahren, was für den Schnitt wichtig ist. Denn es kommt schnell vor, dass der Film aus gestalterischen Gründen genau die gegensätzliche Bewegung benötigt. Jeden Schwenk zweimal hin- und herfahren ist daher in der Filmbranche Standard.

Eine weite Landschaft ist wie geschaffen für Drohnen-Schwenks. Gerade dann sollten diese aber eher langsam ablaufen, um die Zuschauer nicht zu überfordern.
Wie der Horizontalschwenk, läuft auch ein vertikaler Schwenk ab. Dabei steuert man nicht die Drohne, sondern die am Gimbal hängende Kamera mit dem rechten Rändelrad. Auch hier ist etwas Übung Voraussetzung für einen sauberen Schwenk, so dass der Himmel nicht das Bild dominiert. Falls nicht anders gewünscht, empfehlen wir einen Anteil von etwa 20 Prozent Himmel im Bild. Wie bei allen Tipps gilt aber natürlich: Erlaubt ist, was gefällt.
FAHRTENJetzt kommen wir zu den tollsten Möglichkeiten, die eine Drohne bieten kann: Fahrten aller Art. Da zeigen sich die gewaltigen Vorteile einer Drohne, die quasi zu einem schier endlosen Slider wird. Ob Vorwärts-, Rückwärts- oder seitliche Fahrt, die Regeln bleiben gleich: Erst Anfang- und Endbild klarstellen, „Trockenübung“ mit Bildkontrolle und erst mit dem Standbild beginnen. Je länger die Fahrt, desto schwerer wird es, die Geschwindigkeit genau gleich zu halten. Hat man am Horizont ein Stück Himmel, muss man auch darauf achten, dass diese Linie gleichbleibt und keine Wellenbewegung macht. Das fällt einem bei Dreh kaum auf, beim Betrachten auf einem großen Bildschirm im Schnitt dagegen schon. Dann fallen auch Ungleichheiten in der Geschwindigkeit und ungewollte, leichte Auf- und Ab-Bewegungen sofort ins Auge. Ab besten lässt man bei Fahrten den linken Joystick ganz los. Zudem sollte die Fahrt nie länger als nötig sein. Das macht sie variabel einsetzbar, von einer Landschaft bis hin zum Hochzeitsbuffet.

Vor allem seitliche Fahrten sind interessant, wenn die Zuschauer nicht wissen, was sie am Ende erwartet. Hier fliegt die Drohne viele Pflanzreihen ab und in nahezu jeder passiert eine andere Handlung, was die Einstellung spannend macht.
DROHNIEEine der schwereren Bewegungen ist der Drohnie, die eine Rückwärtsbewegung mit einer Aufwärtsbewegung und gleichzeitigem Aufwärtsschwenk kombiniert. Zwar gibt es diese Bewegung genau wie Umkreisungen auch als vorprogrammierte Mastershots in jeder (DJI-) Drohne, allerdings sind die Mastershots zwangsläufig nicht an den Drehort angepasst und gerade im vorprogrammierten Dronie-Shot erfolgt der Aufwärtsschwenk sehr ruckartig. Deshalb empfehlen wir die manuelle Ausführung, was auch gleichzeitig gutes Training für die eigenen Flugfertigkeiten ist, da wir hier beide Joysticks und das Rändelrad gleichzeitig bedienen. Unser Anfangsbild ist eine Naheinstellung von oben auf dem Objekt, welches wir wieder stehen lassen. Dann folgt eine sanfte, behutsam schneller werdende Bewegung nach hinten und oben. Etwa ab der Mitte fangen wir an, mit dem Rändelrad nach oben zu schwenken. Unser Endbild ist eine Totale, mit dem Objekt im unteren Bereich sowie deren unmittelbarer und weiter Umgebung. Idealerweise erstreckt sich die Totale bis zum Horizont.

Größere Drohnen wie die DJI Mavic 3 Pro verfügen über eine Wegpunkt-Funktion, mit der sich präzise Drohnie-Aufnahmen einprogrammieren und automatisch abfliegen lassen. Bei den kleinen, günstigen Drohnen ist Handarbeit oder der entsprechende Mastershot gefragt.
TOP-DOWN-PERSPEKTIVEWer seinen Luftaufnahmen mehr Variation geben will, kann auf die Top-Down-Perspektive zurückgreifen, sprich eine Perspektive aus der Luft direkt nach unten. Hier handelt es sich vor allem um eine Effekteinstellung, welche die Bodenstruktur oder markante Objekte mit klaren Linien in den Vordergrund rückt. Nicht nur bieten solche Aufnahmen eine neue, bisher wenig genutzte Perspektive, sondern bringen eine künstlerische Tiefe - vergleichbar mit Architekturfotos - in eure Projekte. Eine Entwicklung davon ist die Kombination von Top-Down-Perspektive und Drehungen, bei denen durch die drehenden Linien fast schon ein psychedelischer Effekt entsteht.

Wenn wie hier im Bild klare Linien das Bild dominieren, bietet sich die Top-Down-Perspektive an. So bekommt diese Aufnahme einen szenischen Look.
UMKREISUNGENWer Schwenks und Fahrten beherrscht, kann sich an Umkreisungen versuchen. Damit rückt man ein Objekt komplett in den Fokus und stellt es in dessen Umgebung dar. Der Beginn sollte inzwischen bekannt sein: Zuerst Stand- und Endbild sicherstellen, wobei bei Umkreisungen Anfang und Ende oft dieselbe Perspektive sind. Nach dem Standbild beginnen wir mit der seitlichen Fahrt und steuern fast zeitgleich mit einem Schwenk in die entgegengesetzte Richtung gegen. Die Schwierigkeit liegt darin, beide Regler so zu kontrollieren, dass die Bewegung flüssig abläuft und keine merkbaren Ruckler beinhaltet. Üblicherweise erfolgen Umkreisungen entgegen dem Uhrzeigersinn, sprich von links nach rechts, für mehr Variabilität sollte man jedoch auch die Bewegung im Uhrzeigersinn mit aufzeichnen. Bei der Drohnenposition und dem Bildausschnitt sind hingegen keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich sind enge Umkreisungen und steilere Winkel mehr objektfokussiert, während weite Perspektiven mit viel Hintergrund mehr den Kontext von Objekt und Umgebung darstellen

Das Umkreisen gibt es als Mastershot, lässt sich aber manuell oder über Wegpunkte präziser ausführen und variieren.
ZU DEN EINZELTESTS
FAZIT
 Mit den passenden Basisaufnahmen beginnt der Spaß der Nachbearbeitung. Gerade durch den oft hohen Himmelanteil ist zudem ein Color Grading sinnvoll, um die Tiefen eines Tals aus dem Dunkel oder die Spiegelung eines Sees aus dem „Gegenlicht“ zu holen. Doch Luftaufnahmen in hoher Auflösung erlauben auch weitere Spiel- respektive Bewegungsvarianten: Durch eine Kombination mit einen Zoom in oder aus dem Bild heraus entsteht weitere Dynamik. Höhere Bildraten bieten Spielraum für weitere Verlangsamung, aber auch für eine Beschleunigung. Oft liegt der Trick in einer Kombination aus beidem innerhalb eines Clips. Oft wird genau damit erst aus einer gewöhnlichen Luftaufnahme etwas Besonders. Und auch hier gilt: Übung macht den Meister!
Mit den passenden Basisaufnahmen beginnt der Spaß der Nachbearbeitung. Gerade durch den oft hohen Himmelanteil ist zudem ein Color Grading sinnvoll, um die Tiefen eines Tals aus dem Dunkel oder die Spiegelung eines Sees aus dem „Gegenlicht“ zu holen. Doch Luftaufnahmen in hoher Auflösung erlauben auch weitere Spiel- respektive Bewegungsvarianten: Durch eine Kombination mit einen Zoom in oder aus dem Bild heraus entsteht weitere Dynamik. Höhere Bildraten bieten Spielraum für weitere Verlangsamung, aber auch für eine Beschleunigung. Oft liegt der Trick in einer Kombination aus beidem innerhalb eines Clips. Oft wird genau damit erst aus einer gewöhnlichen Luftaufnahme etwas Besonders. Und auch hier gilt: Übung macht den Meister!
Autoren: Martin Gremmelspacher, Joachim Sauer, Jonas Schupp / Bilder: Jonas Schupp, Joachim Sauer MEDIENBUREAU
Viele weitere spannende Themen, Tests und Ratgeber gibt
Autor: |
Bildquellen: |
Weitere Praxis-Artikel

Praxistest: Datacolor LightColor Meter – mehr als ein Belichtungsmesser
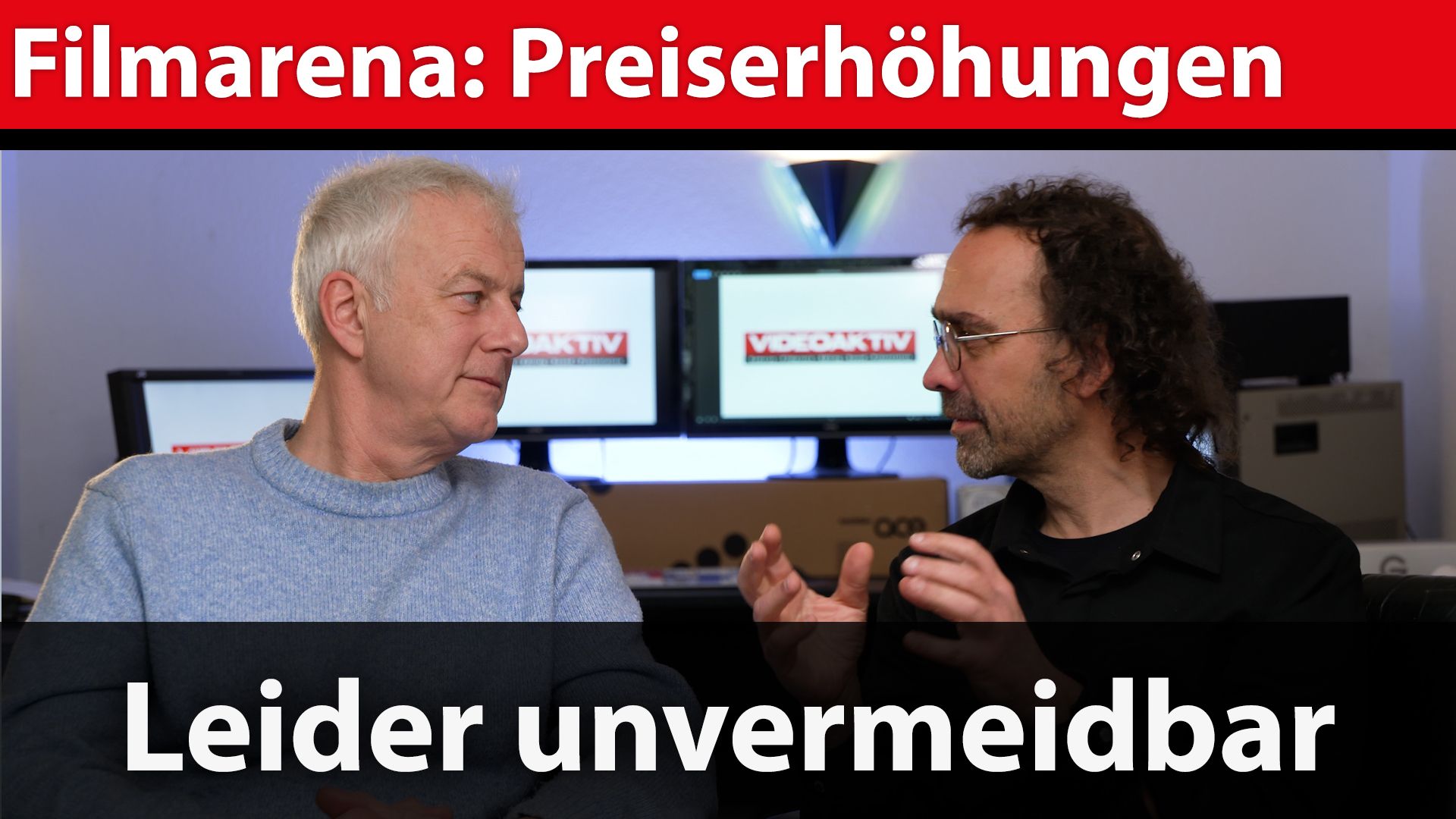
Filmarena: Preiserhöhungen – unvermeidbar, aber unangenehm






